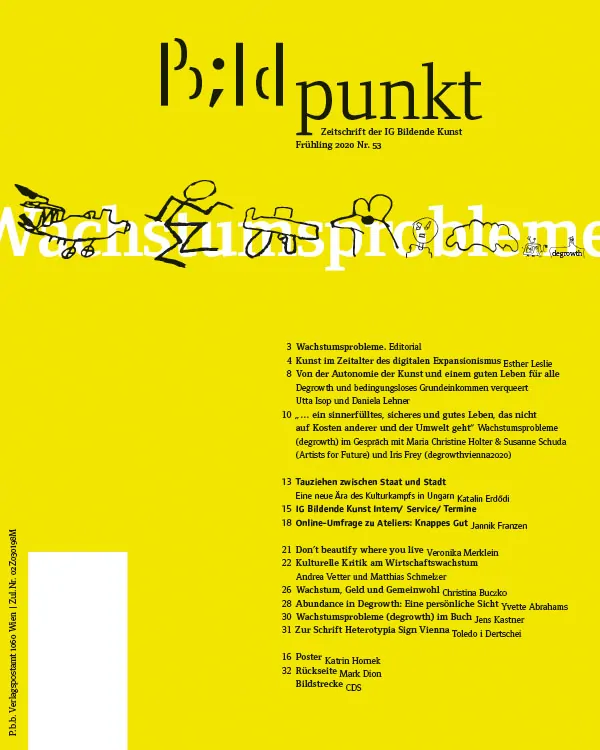Was wollen wir ändern? Und warum?
Einerseits werden Milliarden Menschen als „überflüssig“ gewertet und ihr Tod in Kauf genommen. Andererseits tendiert die menschliche Spezies dazu, sich selbst überflüssig zu machen. Durch ökologische Krisen bedrohen und vernichten wir unsere Existenz und die anderer Lebewesen. Wenn wir das Sterben stoppen wollen, müssen wir unser Zusammenleben neu organisieren. Dafür gibt es viele Ideen in sozialen Bewegungen, Degrowth und das bedingungsloses Grundeinkommen (Basic Income) sind zwei davon. Demokratisierung und das Leben in Vielfalt ebenfalls.
Postwachstum/ Degrowth
Die Degrowth-Bewegung will eine Veränderung der derzeitigen gesellschaftlichen Strukturen, von einer Wachstums- zu einer Postwachstumsgesellschaft. Die Kommodifizierungs- und Verwertungslogik von Leben soll zu einer Logik der Lebensqualität für alle werden. Dazu braucht es Imaginationen nicht kapitalistischer Realitäten und konkrete Schritte wie Commons, Care- Communities und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das I.L.A. Kollektiv, das sich als Werkstatt für globale Gerechtigkeit versteht, beschreibt Wege in die solidarische Lebensweise wie FoodCoops, solidarische Landwirtschaftsinitiativen, Wohnungs- und Energiegenossenschaften, Tauschläden, Repair-Cafés, Nachbarschaftshilfen, Gemeinschaftsgärten, Open Source-, Wohnprojekte und andere Initiativen. Jedoch ist es nicht allen Menschen möglich, sich an solchen Initiativen zu beteiligen. Es braucht strukturelle Veränderungen für eine Postwachstumsgesellschaft. Das bedingungslose Grundeinkommen kann zu einer solidarischen Lebensweise beitragen, da die Arbeit dadurch keiner Geldlogik unterliegt.
Geld
Geld steht im Zentrum der Kritik von Degrowth, und Geld stellt das zentrale Beziehungsmittel des bedingungslosen Grundeinkommens dar. Geldgesellschaften drängten durch ihre Dominanz andere Herrschaftsstrukturen wie Herkunft, Geschlecht, Religion, Ability, sexuelle Orientierung und viele mehr zurück. Geld führte zu neuen dominanten Netzwerken in Geldgesellschaften. Diese kooperierten entweder mit den traditionelleren Herrschaftsstrukturen oder entmachteten diese. Nun besteht eine Lösung für die tödliche Dynamik zwischen Armen und Reichen, Starken und Schwachen und vielen anderen einander bedrohenden Gruppen darin, das Geld zum Überleben allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Dies schlägt das Basic Income in Verbindung mit vielen verschiedenen Begleitmaßnahmen und Varianten vor. Das bedingungslose Grundeinkommen stärkt die Verhandlungsmacht am Arbeitsmarkt und die Autonomie in Bezug auf die eigene Arbeitskraft. Die Wirkungen auf die unbezahlte Sorgearbeit sind umstritten. Durch das Basic Income werden die Dominanz von Geld und dessen Eliten in Frage gestellt. Weiter gehen die Ideen im Themenspektrum von Degrowth. Hier geht es darum, das Wachstum von Geld und damit die zentralen Beziehungsstrukturen von Geld abzuschaffen. Dies eröffnet die Frage, welche anderen „sozialen Bindemittel“ (außer Geld, Religion, Herkunft, Geschlecht, Ethnien, Nationen) Gesellschaften auf friedliche Weise verknüpfen können.
Kunst & Autonomie
Künstler*innen beteiligen sich aktiv in sozialen Bewegungen und üben gesellschaftliche Kritik. Die Autonomie der Kunst, die Distanz zu Netzwerken der Macht und das Üben von Kritik entfaltet sich in Freiheit von Herrschaftsstrukturen des Geldes, des Nepotismus, der Freunderlwirtschaft. Kunst kann mit einem bedingungslosen Grundeinkommen völlig neue Dimensionen der Autonomie erlangen. Dann bietet Kunst die Möglichkeit, Narrative von Solidarität und gemeinsamem Handeln zu erzählen. Joseph Beuys sah Küntsler*innen als „changeagents“ und die soziale Plastik als ein Erkunden von Freiheit in Verantwortung. Shelley Sacks & Hildegard Kurt (2013, S. 17), Pionierinnen in der sozialen Plastik, schreiben: „Was jetzt gebraucht wird, sind neue gesellschaftliche und sozialen Einsichten und Praktiken, die zur Herausbildung von direkter Demokratie, Selbstorganisation und Grundeinkommen beitragen sowie neue Wirtschaftsformen und Bildungspraktiken, die die Entfaltung des Menschen – eines anderen Menschseins – fördern. Praktiken, die uns befähigen, hinab auf die Ebene der Gewohnheiten zu gelangen; die uns befähigen, die fundamentale Beziehung zwischen innerer und äußerer Arbeit zu erleben.“ Diese Beziehung ermöglicht es auch, die entfremdeten Formen des Kapitalismus zu verändern.
Kann „ein gutes Leben für alle“ darin bestehen, mit den „richtigen Leuten“ befreundet zu sein?
Welche Beziehungsstrukturen ermöglichen es, weltweit allen Menschen so selbstbestimmt wie möglich, ein gutes Leben zu führen, ohne andere Lebewesen oder die Natur zu zerstören? Welche Beziehungsstrukturen ermöglichen ein Maximum an Freiheit und Autonomie für einzelne Lebewesen mit einem gleichzeitigen Minimum an Gewalt gegenüber anderen Lebewesen? Dafür reicht es nicht, eine Herrschaftsstruktur wie das Geld in Frage zu stellen. Verschiedene Herrschaftsstrukturen und Gewaltformen wie Herkunft, Religion, Geschlecht, Ethnie, Nationalität, Eigentum und vieles mehr müssen immer wieder neu kritisiert und abgebaut werden. Freiheit und Autonomie in einer Postwachstumsgesellschaft, die sich von Geldbeziehungen löst, kann nicht darin bestehen, mit den „richtigen Leuten“ befreundet zu sein. Wenn es uns Geld ermöglicht, andere Netzwerke der Macht zu distanzieren, sollten wir bei der Entmachtung der Netzwerke des Geldes darauf achten, dass wir nicht anderen Netzwerken der Herrschaft in die Hände spielen!
Demokratisierung: Macht teilen!
Um die Macht von Geld, Staat, Religion, Herkunft, Geschlecht und vielen anderen Herrschaftsformen abzubauen, benötigen wir Beziehungen, die Macht teilen! Beziehungen, die Macht teilen, können durch verschiedene Praktiken gelebt werden: dadurch, dominante Beziehungsformen, wie die des Geldes, immer wieder abzubauen. Dadurch, Praktiken des Teilens von Macht wie das Rotieren und Losen von Zugängen zu Ressourcen und Institutionen zu leben. Dadurch die Arbeitswelten zu demokratisieren. Dadurch, allen Menschen Zugang zu Macht zu garantieren! Dadurch, die geschlossenen Netzwerke der Macht zu queeren!
Utta Isop lebt als freie Wissenschafterin/ Philosophin in Klagenfurt und Wien. Sie lehrt an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt.
Daniela Lehner ist Universitätsassistentin am Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung an der Universität Klagenfurt und forscht zu Transformativen Bildungs- und Lernprozessen für ein gutes Leben für alle.
Literatur I.L.A. Kollektiv (Hg.), Das Gute Leben für Alle. Wege in die solidarische Lebensweise. München 2019, oekom.
Hildegard Kurt, Shelley Sacks, Die rote Blume. Ästhetische Praxis in Zeiten des Wandels. Klein Jasedow 2013, thinkOya.